Ich war also Mutter geworden. Ende zwanzig und enttäuscht versuchte ich dazuzugehören. Wollte mit anderen Müttern Zeit verbringen, damit das alles etwas leichter werden würde. Alleine zuhause klappt das natürlich nur schlecht. Und da es weder Zeitungsannoncen zu diesem Thema gibt, noch Freundinnen aus Nettigkeit plötzlich ein Baby haben können, muss man sich auf die Suche machen. Und das tat ich. Was ich fand, waren glückliche Mütter unter sich.
Kinderlieder singend mit anderen Müttern im Kreis zu laufen: Im Nachhinein an Komik kaum zu überbieten. Der Verzweiflung halber, um nicht völlig zu vereinsamen, habe ich es getan. Denn ich war vereinsamt. Diese sehr spezielle Form der Einsamkeit wird dadurch pervertiert, dass man einfach nicht alleine ist. Dass man sich, isoliert vom Rest der Welt, nichts mehr wünscht als seine Ruhe. Wenigstens mal kurz. Mir wurde schnell klar, dass das moderne, westliche Modell der Großstadt-Kleinfamilie irgendwie seine Mängel hat. Wer mit einem Säugling in seiner Wohnung sitzt und es trotzdem nicht schafft zu duschen, darf wohl irgendwann daran zweifeln, ob das mit dieser Auflösung der dörflichen Strukturen eine so gute Idee war.
Ohne Vernetzung mit anderen Müttern saß ich also morgens um sechs Uhr müde in der Küche und fragte mich, wie viele Stunden ich das schreiende Baby durch die Wohnung getragen haben werde, bis ich mich um 16:30 Uhr endlich mit der Freundin auf einen Tee treffen kann. Nur um dann glücklich lächeln zu müssen, wie schön das alles sei. Eine Auszeit, wie das Ganze auch gerne mal euphemistisch bezeichnet wird, ist das erste Babyjahr nun wirklich nicht. Ein Urlaub auf La Palma oder ein Wochenende im Alpen-Spa – das sind Auszeiten. Die Elternzeit ist eine 7-Tage-Woche ohne Kaffeepause und Vergütung, die auch noch Spaß machen soll. Nur sagt einem das keiner. Jeden Reiseveranstalter hätte man längst verklagt.
Mein Baby und ich glichen uns wenigstens emotional wie aus dem Ei gepellt. Wir waren beide permanent überreizt und gelangweilt zugleich. Ich meldete mich also zu diesen Kursen an, entschlossen und anspruchslos. Der Plan: Mit anderen meine Gefühle teilen. Ich wollte endlich hören, dass das wirklich krass ist. Am ersten Vormittag auf einer Turnmatte, als wir zu acht im Kreis um ein paar orange-gelbe Tücher saßen und den Tag besangen, fühlte ich mich wie in der Laminat-Abteilung im Baumarkt: betrogen und frustriert. Das war alles irgendwie nur Fake. Alles tat so. Hell und bunt, freudig und gesprächig tat dieser Ort, als sei alles in Ordnung. Und ich sehr falsch.
Ich dachte, wir weinen zusammen. Aber diese Frauen waren zusammengekommen, um ihr Glück zu teilen. Diesen Veranstaltungen fehlte das echte Leben. Sie waren konstruiert für diese originelle erste Baby-Zeit. Gefüllt mit drolligen Ritualen, die in der Regel eine Abspaltung meiner Persönlichkeit voraussetzten, damit ich weder in einen Lachanfall noch in Tränen ausbrechen musste. Die bloße Beschäftigung fabrikneuer Mütter mit dem ewigen Gerede über Selbstaufgabe. Und Glück. Ich war desillusioniert. Nicht mal die, die das gleiche durchmachten wie ich, sprachen darüber. Meine Zweifel, selbst an meiner Unhappieness Schuld zu sein, wurden über die Wochen größer und größer. Ich ging in dem Gesäusel und gefühlsüberfrachteten Strudel der Mutterwelt nicht auf, sondern unter. Es lief nicht gut. Und ich war sicher, meine Sache schlecht zu machen. Also zog ich mich zurück und war wirklich überfordert.
Man hatte mir vorgemacht, es sei der neuronale Dauerorgasmus, von dem wir fortan in Ekstase versetzt, an nichts anderes mehr denken wollen. Das i-Tüpfelchen. Lifegoal. Ab dann brauche es nie mehr. Dabei bedeutet es für viele Frauen zunächst Einsamkeit und Traurigkeit. Dinge, die wir mit dem Mutterwerden so gar nicht verbinden. Wir sollen es lieben, Schmerzen zu haben, es lieben, völlig übernächtigt zu sein, es lieben, im Job bald nicht mehr vorwärtszukommen, es lieben, finanziell schlechter dazustehen, es lieben, einige Jahre körperliche und seelische Belange einem anderen Menschen unterzuordnen – und selbst wenn uns zugestanden wird, diese Dinge „hart“ zu nennen, dann muss am Ende des Satzes immer noch das Aber stehen. Aber es ist das Schönste auf der Welt. Aber?
Als Mutter glücklich zu sein, ist also vor allem eines – harte Arbeit. Es ist ein ständiges Abwägen von Kräften, Aufschieben und Wahrnehmen von Bedürfnissen, Organisation und Rechtfertigung. Wer wann was wie viel und warum braucht und vor allem man selbst, das ist Business. Wer es dabei schafft, glücklich zu sein, leistet viel. Das als Selbstverständlichkeit abzutun, schmälert die psychische Leistung jeder Frau, die sich mit dieser Rolle konfrontiert. Denn Mütter scheitern in unserer Gesellschaft nicht an den nicht fehlenden Gefühlen zu ihrem Kind, sie scheitern an dem Ideal der Mutterliebe.
Ihr habt Tante Kantes erste und zweite Kolumne verpasst? Hier könnt ihr sie nachlesen:
Kleiner Fuckt am Rande: Wir beginnen am Ende
Kleiner Fuckt am Rande: Kinder lieben – Die Vogelperspektive
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
![]() Lust auf mehr? Um über aktuelle Beiträge, Elterntipps, Rezeptideen, Bastelanleitungen und mehr auf dem Laufenden zu bleiben, hol dir unseren Newsletter und folge uns bei Instagram, Pinterest und Facebook!
Lust auf mehr? Um über aktuelle Beiträge, Elterntipps, Rezeptideen, Bastelanleitungen und mehr auf dem Laufenden zu bleiben, hol dir unseren Newsletter und folge uns bei Instagram, Pinterest und Facebook!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
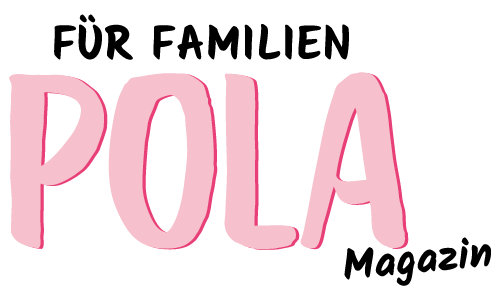






Es ist sehr erleichternd endlich auch mal solche Texte zu lesen. Bei uns war es ähnlich. Ich hatte ein dauerhaft unzufriedenes Kind, das viel zu aktiv war und hatte viel zu wenig Schlaf, mir war unglaublich langweilig und das bei viel zu hoher Auslastung. Ich habe mich ausgestoßen gefühlt weil mich keiner verstanden hat und bin bis heute sehr sensibel bei Eltern die mir erzählen wie toll alles ist und wie schön das entschleunigt. Das sind auch genau die Mütter die im Park gemeinsam auf einer Picknickdecke sitzen und quatschen während ihre Kinder sich intensiv Grashalme anschauen. Auf die konnte ich nur neidisch sein.